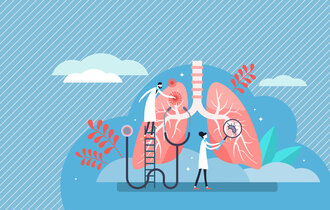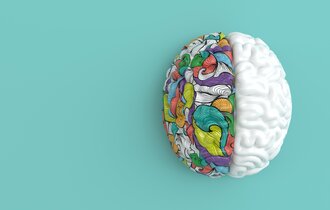Allergien stellen gerade in Industrieländern ein stark verbreitetes und zunehmendes Phänomen dar. Mindestens jeder vierte Deutsche ist im Laufe seines Lebens betroffen. Doch was genau ist eine Allergie, wie entsteht sie und welche Formen gibt es? Hier finden Sie die Antworten.
Was ist eine Allergie?
Allergien sind Fehlfunktionen des Immunsystems. Normalerweise schützt uns dieses vor Krankheitserregern wie Bakterien oder Viren. Bei einer Allergie reagiert unser Körper jedoch überempfindlich auf eigentlich harmlose Stoffe, so als würden sie eine echte Bedrohung darstellen. Die Immunreaktionen fallen je nach Allergie unterschiedlich aus: Von Niesen, Husten, laufender Nase, tränenden Augen, juckender Haut bis hin zu Magenschmerzen, Kopfschmerzen oder Verschlechterung der Atmung. Da unsere Haut und Schleimhäute die ersten Berührungspunkte für Fremdstoffe aus der Umwelt bilden, sind sie am häufigsten von allergischen Reaktionen betroffen.
Die allergieauslösenden Stoffe werden als Allergene bezeichnet. Sie können sowohl einen natürlichen als auch einen künstlichen Ursprung haben. Zumeist sind es Eiweißverbindungen. Zum Beispiel kann es sich um bestimmte Nahrungsbestandteile handeln, um Blütenpollen, Hausstaub oder Inhaltsstoffe von Medikamenten.
Welche Prozesse laufen im Körper ab?
Was genau im Körper geschieht, unterscheidet sich je nach Allergietyp. Jeder Allergie geht zunächst die Sensibilisierung voraus. Dringen Allergene zum ersten Mal in die Schleimhaut ein, bezeichnet man dies als Erstkontakt. In den meisten Fällen bildet das Immunsystem daraufhin Antikörper, zum Beispiel die Immunglobuline E (IgE) im Fall von Typ I. Bei diesem weit verbreiteten Typ kommen auch die Mastzellen ins Spiel. Sie übernehmen bei der Abwehr von Krankheitserregern eine wichtige Rolle. Die Antikörper werden an Rezeptoren der Mastzellen gebunden, die dadurch gegen das Allergen sensibilisiert sind.
Bei erneutem Kontakt docken die Eiweißverbindungen der Allergene an die Antikörper der Mastzellen an. Es folgt die Abwehrreaktion: Die Mastzelle schüttet das in ihr gespeicherte Histamin und andere Entzündungsbotenstoffe aus. Diese bewirken dann die allergischen Symptome wie Anschwellen der Haut, Juckreiz, Quaddelbildung oder Verengung der Atemwege. Allerdings muss eine erstmalige Abwehrreaktion nicht unbedingt schon beim zweiten Kontakt mit dem Allergen stattfinden. Die Sensibilisierungsphase kann sich über Jahre erstrecken und führt nicht zwangsläufig zum Ausbruch der Allergie.

Welche Allergietypen gibt es?
Je nach Art der Reaktion werden vier Typen unterschieden. Typ I ist der mit Abstand häufigste Reaktionstyp. Symptome treten hier bereits auf, kurz nachdem der Körper Kontakt mit dem Allergen hatte. Darunter finden sich zum Beispiel die Hausstauballergie oder der weit verbreitete Heuschnupfen. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Merkmale der einzelnen Typen zusammen:
| Bezeichnung (Typ) | Art bzw. Ablauf der Reaktion | Dauer vom Kontakt zum Auftreten von Symptomen | Beispiele |
|---|---|---|---|
| Typ 1 Soforttyp | Vermittlung durch IgE-Antikörper; Freisetzung von Botenstoffen wie Histamin | wenige Sekunden bis Minuten (evtl. 2. Reaktion nach 4-6 Stunden) | allergische Rhinitis/ Konjunktivitis allergisches Asthma Nesselsucht Insektengiftallergie Hausstauballergie Pollenallergie anaphylaktischer Schock |
Typ II | Bildung von Komplexen aus Antigenen und Antikörpern; Zerstörung körpereigener Zellen | 6 bis 12 Stunden | Transfusionsreaktionen Arzneimittelallergien Autoimmunerkrankungen |
| Typ III Immunkomplextyp | Bildung von Antigen-Antikörper-Komplexen; Freisetzung Gewebe schädigender Substanzen | 6 bis 12 Stunden | allergische Gefäßentzündung (Vaskulitis) Serumkrankheit exogen-allergische Alveolitis (z. B. Farmerlunge) |
| Typ IV Spättyp | Vermittlung durch Zellen (T-Lymphozyten) | 12 bis 72 Stunden | allergisches Kontaktekzem Arzneimittel-Reaktionen Abstoßungsreaktionen von Transplantaten |
Allergien sind als chronische Erkrankungen ernst zu nehmen. Die Symptome können zu einem anaphylaktischen Schock führen und lebensbedrohlich werden. Daher sollte man sie nicht unterschätzen.
Hilfe zur Sebsthilfe
www.daab.de
Der Deutsche Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB) bietet auf www.daab.de ein breites Spektrum an Informationen zum gesamten Themenbereich.
www.allum.de
Allum wendet sich an Eltern, Betroffene und Fachleute. Kinderärzte und Naturwissenschaftler der gemeinnützigen Kinderumwelt GmbH informieren über sinnvolle Vorbeugemaßnahmen und Behandlungsmöglichkeiten.
www.gpau.de
Unter dieser Adresse können Sie den Eltern-Ratgeber der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin (GPA) e.V. online einsehen und sich anhand wissenschaftlich fundierter Informationen auf dem neusten Stand halten. Unter „Die Zeitschrift“ finden Sie den Eltern-Ratgeber mit den aktuellen Ausgaben und den Jahrgängen 1998 – 2013.
www.pina-infoline.de
Hier finden Sie das Präventions- und Informationsnetzwerk Allergie/Asthma e.V. Durch die Zusammenarbeit mit der Kinderumwelt GmbH werden kompetenteInformationen geliefert. Die Rubrik „Häufig gestellte Fragen“ bietet einen schnellen Zugang zu den Antworten auf die meistgestellten Anfragen. Mit einem Klick auf „Das Allergie Buch“ erhalten Sie einen virtuellen Ratgeber zum Thema „Allergien und Asthma bei Kindern und Jugendlichen“.
www.asthmaschulung.de
Die Arbeitsgemeinschaft Asthmaschulung im Kindesund Jugendalter e.V. gibt auf ihrer Seite eine Einführung in das Krankheitsbild Asthma bronchiale und bietet eine umfassende Informationsquelle zum Thema Asthmaschulung.
www.wetter.com
Aktuelle Pollenflug-Vorhersagen finden Sie beim Deutschen Wetter-Dienst (DWD) unter „Gesundheitswetter“.
Für viele Handynutzer ist die Welt ohne Apps kaum noch vorstellbar. Sie finden eine große Vielfalt im Netz. Wir empfehlen Ihnen einen kritischen Umgang mit diesen Angeboten. Häufig sind die Beratungsplattformen mit Produktwerbungen verknüpft. Eine Empfehlung können wir aus diesem Grund nicht aussprechen.
www.aak.de
Unter www.aak.de erreichen Sie die Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind e.V. Dort werden Bestellmöglichkeiten von Informationsbroschüren genannt und Informationen zum Thema Allergien zur Verfügung gestellt.
www.selbsthilfe-buero.de
Das Selbsthilfe-Büro Niedersachsen ist eine landesweite Service-, Informations- und Koordinierungseinrichtung für die Selbsthilfe in Niedersachsen.
www.selbsthilfe-wegweiser.de
Das Netzwerk Selbsthilfe Bremen-Nordniedersachsen e.V. ist eine regionale Kontaktstelle der Selbsthilfe. Hier erhalten Sie Kontaktdaten von bestehenden Gruppen und Unterstützung bei der Gründung einer Gruppe.
www.nakos.de
Die Nationale Kontakt- und Informationsstelle bietet Selbsthilfegruppen Unterstützung und dient bundesweit als Plattform für alle Gruppen.
Literatur zu Allergien
- „Richtig einkaufen bei Nahrungsmittel-Allergie“,
Dr. I. Reese, A. Constien, C. Schäfer; TRIAS Verlag
ISBN 978-3-8304-3351-4
- „Der Luftikurs für Kinder mit Asthma“
S. Theiling, R. Szczepanski, Th. Lob-Corzilius;
PABST SCIENCE PUBLISHERS
ISBN 978-3-89967-694-5
- „Das TRIAS-Kochbuch für Kreuz-Allergiker“
C. Schäfer, A. Kamp; TRIAS Verlag
ISBN 978-3-8304-3439-9
- „Neurodermitis – das juckt uns nicht!“
R. Szczepanski, M. Schon, Th. Lob-Corzilius;
PABST SCIENCE PUBLISHERS
ISBN 978-3-89967-544-3
- „Allergien vorbeugen – Allergieprävention heute“
Dr. I. Reese, C. Schäfer; Systemed Verlag
ISBN 978-3-927372-50-4
- „Rezepte ohne Milch, Ei, Weizen und Soja“
C. Schäfer, B. Schäfer; GU Verlag
ISBN 978-3-8338-2313-8
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.
Fliethstraße 114, 41061 Mönchengladbach
Tel. 02161 814940 · www.daab.de
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.
Godesberger Allee 18, 53175 Bonn
Tel. 0228 3776600 · www.dge.de
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (BMELV)
Aktionsplan gegen Allergien11055 Berlin
Tel. 030 185290 · www.bmelv.de
Bitte beachten Sie: Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Titel sind nicht bei der hkk, sondern nur unter den angegebenen Quellen oder im Buchhandel erhältlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr.